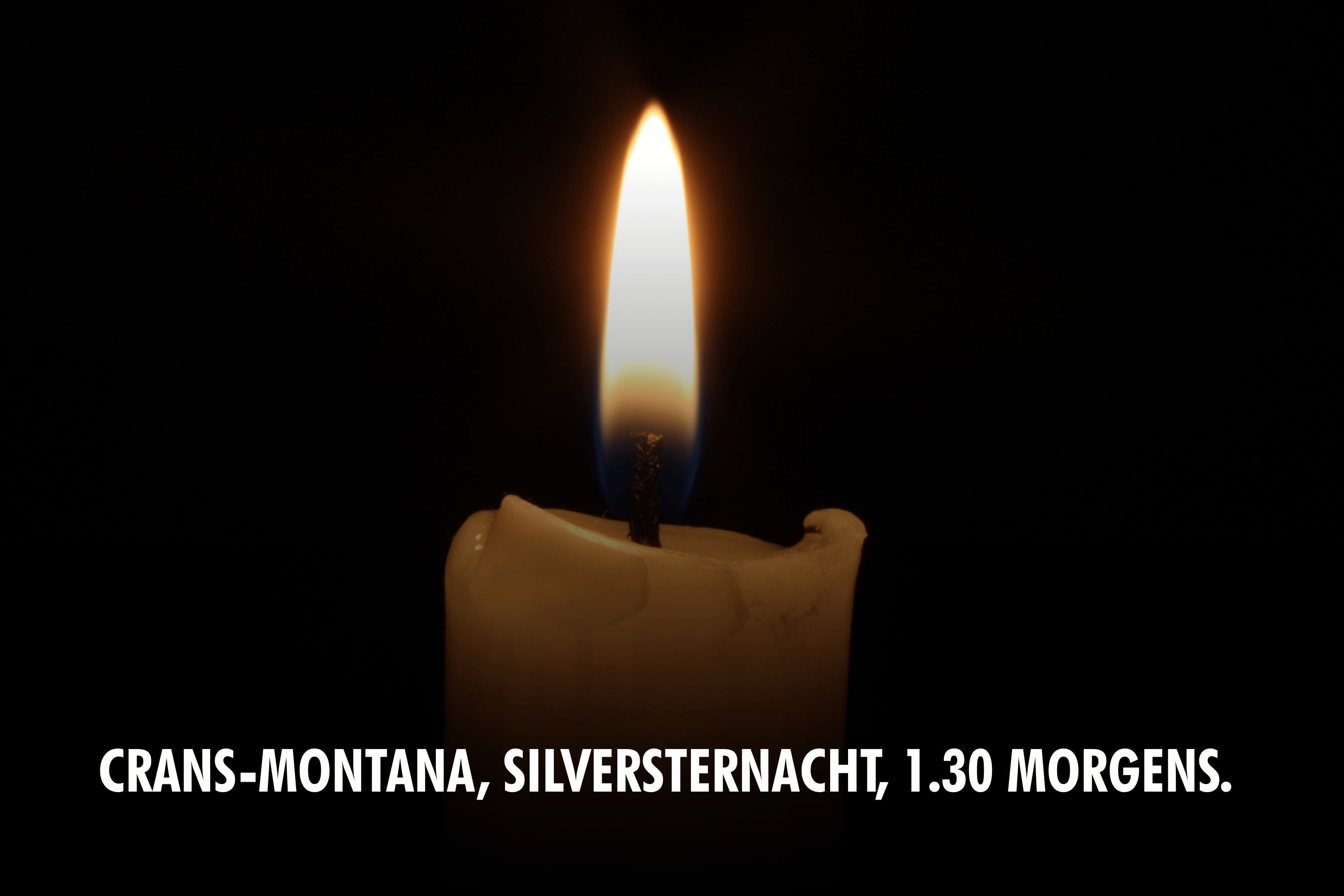Crans-Montana, Silversternacht, 1.30 Morgens. Brandalarm. Tote, Verletzte.
Ich habe die Nachricht mehrmals gelesen. Nicht, weil ich sie nicht verstanden hätte, sondern weil mein Kopf sie nicht einordnen wollte. Ein Nachtclub. Crans-Montana. Schweiz. Und mindestens vierzig Tote. Vor allem junge Menschen. Teenager. Junge Erwachsene. Kinder eigentlich.
Man liest so etwas sonst aus anderen Ländern. Aus Städten, die „weit weg“ sind. Aus Systemen, bei denen man innerlich sofort denkt: Dort läuft vieles schief. Venezuela zum Beispiel, aber da wird ja jetzt alles gut, oder? Aber hier? Bei uns?
Was mich besonders getroffen hat? Das Alter. Der jüngste bekannte Todesfall: 14 Jahre. Vierzehn.
Ich bin Vater von zwei Töchtern, die jüngere ist 16. Und in dem Moment hört jede statistische Distanz auf. Man denkt nicht mehr abstrakt. Man denkt nicht mehr politisch. Man denkt nicht mehr strukturell. Man denkt an ein Kind. An ein Elternhaus. An einen Abend, der ganz normal begonnen hat und nie hätte so enden dürfen.
Ich habe von einem Vater aus Mailand gelesen, der um seine 16-jährige Tochter trauert. Ich kenne diesen Mann nicht. Aber ich kenne diesen Schmerz zumindest in der Vorstellung. Und das reicht, um einen innerlich still werden zu lassen.
Was sagt man Eltern, die ihr Kind verloren haben? Es gibt keine Worte. Alles klingt hohl. Alles wirkt falsch. Worthülsen, blabla, man klingt wie Politiker die bei jedem Terroranschlag, bei jeder Katastrophe, betroffen schwafeln und einen Kranz schicken.
Und vielleicht ist genau das der Punkt? Man sollte zuerst gar nichts sagen. Sondern einfach anerkennen, dass etwas Unumkehrbares passiert ist.
Diese jungen Menschen hatten ihr Leben noch vor sich. Pläne, die banal waren und gerade deshalb wertvoll. Ein nächstes Wochenende. Ferien. Schule, Ausbildung, erste Liebe, vielleicht auch erste Enttäuschungen. All das ist jetzt weg.
Tragödien haben die unangenehme Eigenschaft, alles zu relativieren. Termine, Diskussionen, Ärgernisse – plötzlich wirken sie klein. Lächerlich fast. Was bleibt, ist diese Schwere. Dieses dumpfe Gefühl im Magen. Dieses „Das hätte nicht passieren dürfen“.
Noch ist vieles unklar. Und es ist nicht der Moment für Schuldzuweisungen. Aber es ist der Moment für Respekt. Für Stille. Für Mitgefühl.
Und vielleicht auch für Ehrlichkeit: Dass uns solche Nachrichten nicht nur „betreffen“, sondern angehen. Weil es unsere Kinder sind. Unsere Gesellschaft. Unser Land.
Bevor wir anfangen zu diskutieren, zu analysieren oder zu rechnen, sollten wir eines festhalten: Hier sind junge Menschen gestorben, die unter unserem gemeinsamen Schutz standen.
Und genau deshalb darf man später Fragen stellen. Nicht aus Sensationslust. Nicht aus Klickgier. Sondern aus Verantwortung. Aber zuerst: Trauer. Und ein stilles Innehalten.
Die Fragen, die gestellt werden müssen
Nach jeder Tragödie kommt ein Moment, den viele fürchten. Der Moment, in dem man beginnt, Fragen zu stellen.
Manche empfinden das als pietätlos. Als zu früh. Als unangebracht. Ich sehe das anders. Fragen zu stellen ist kein Angriff auf die Opfer. Im Gegenteil: Es ist das Mindeste, was man ihnen schuldet.
Noch sind nicht alle Fakten geklärt. Ermittlungen laufen. Aussagen widersprechen sich. Das ist normal. Und genau deshalb geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Verantwortung – als System, als Gesellschaft.
Einige Fragen drängen sich dennoch auf. Nicht, weil sie spektakulär wären, sondern weil sie banal sind. Und gerade deshalb gefährlich, wenn sie unbeantwortet bleiben.
Warum waren offenbar sehr junge Jugendliche in den frühen Morgenstunden in einem Nachtclub, in dem harter Alkohol ausgeschenkt wurde? Ich kann auch bei einem 14-jährigen Opfer sagen – warum zum Geier werden Kinder in Nachtclubs gelassen? Vierzehn Jahre alt. Und sonst machen wir ja bei allem einen auf Supermoral oder? Das ist kein Grenzfall. Das ist keine Grauzone.
Warum gibt es Berichte über einen zweiten Eingang mit PIN-Code, an dem angeblich keine Alterskontrollen stattfanden? Sollte sich das bestätigen, wäre das kein organisatorisches Versehen, sondern ein bewusstes Umgehen von Regeln.
Warum wurde das Lokal offenbar über Jahre hinweg nicht oder nur unzureichend von den zuständigen Stellen in Bezug auf Feuer- und Sicherheitsauflagen kontrolliert? In einem Land, das für seine Genauigkeit, seine Vorschriften und seine Kontrollen bekannt ist.
Und hier geht es nicht um „den Betreiber“ oder „die Behörde“. Es geht um eine Kette von Zuständigkeiten. Gemeinde. Kanton. Aufsichtsstellen. Betreiber. Veranstalter. Ordnungsdienste. Wenn an mehreren Stellen weggeschaut wird, entsteht kein Zufall. Es entsteht ein System.
Die Schweiz ist kein Land mit schlechten Gesetzen. Im Gegenteil. Unsere Regeln sind in vielen Bereichen streng, detailliert und klar. Aber Regeln schützen nur dann, wenn sie auch durchgesetzt werden. Und nicht nur auf dem Papier existieren.
Vielleicht war es Nachlässigkeit. Vielleicht Überforderung. Vielleicht Bequemlichkeit. Vielleicht auch dieses typisch schweizerische „Es ist ja bisher gut gegangen“. All das wird zu klären sein.
Was mich beunruhigt, ist nicht die Möglichkeit von Fehlern. Fehler passieren. Was mich beunruhigt, ist die Vorstellung, dass man Risiken kennt – und sie trotzdem hinnimmt.
Dass man Ausnahmen zur Normalität werden lässt. Dass man Kontrolle delegiert, ohne nachzufragen. Dass man Verantwortung verwaltet, statt sie wahrzunehmen.
Diese Fragen sind unbequem. Aber sie sind notwendig.
Denn wenn wir sie nicht stellen, werden wir beim nächsten Mal wieder sagen: So etwas hätte man nicht kommen sehen. Und genau das stimmt fast nie.
Der Preis für das Wegschauen ist auch ein Frankenpreis
Neben all der Trauer gibt es eine zweite Realität, die man nicht ignorieren kann, auch wenn sie unangenehm ist. Tragödien enden nicht an der Landesgrenze. Und sie bleiben nicht lokal.
Innerhalb weniger Stunden tauchten international Artikel auf. Nicht nur nüchterne Meldungen, sondern Kommentare, Einordnungen, Vergleiche. Fragen nach Schweizer Sicherheitsstandards. Nach Kontrollen. Nach Verantwortung. Nach einem Land, das sich seit Jahrzehnten als organisiert, sicher und zuverlässig positioniert. War die Schweiz etwa gar nicht so gut und perfekt wie immer alle geglaubt haben?
Die Schweiz lebt nicht nur von Bergen, Seen und Luxusuhren. Sie lebt von Vertrauen. Und Vertrauen ist ein wirtschaftlicher Faktor – vielleicht der wichtigste überhaupt.
Tourismus ist dabei besonders sensibel. Er basiert nicht auf Faktenblättern, sondern auf Gefühlen: Ist es sicher? Kann ich meine Kinder dort ohne Angst ausgehen lassen? Funktionieren die Institutionen? Wird etwas vertuscht (Vätterliwertschaft)?
Wenn dieses Gefühl beschädigt wird, passiert etwas Subtiles, aber Wirksames:
- Familien wählen ein anderes Reiseziel
- Veranstalter werden vorsichtiger
- internationale Medien greifen Narrative auf, die sich nur schwer wieder einfangen lassen
Man darf sich nichts vormachen. Ein einziger Vorfall kann Jahre an aufgebautem Image beschädigen.
Was kostet das konkret? Solche Schäden lassen sich nicht auf den Franken genau beziffern – zumindest nicht sofort. Aber internationale Vergleichsfälle zeigen eine Grössenordnung:
- Rückgänge bei Buchungen in betroffenen Regionen von 5–15 % über mehrere Saisons
- höhere Versicherungsprämien für Veranstalter und Betreiber
- zusätzliche Sicherheitsauflagen, die spät – aber dann abrupt – durchgesetzt werden
- Investitionen in Krisenkommunikation, Recht, Reputationsmanagement
Für einen Hochpreis-Tourismusstandort wie die Schweiz kann das schnell in die hunderte Millionen Franken gehen – nicht kurzfristig, sondern schleichend, über Jahre. Und hier liegt der eigentliche Widerspruch. Oft wären die Kosten für konsequente Kontrollen, saubere Aufsicht und klare Durchsetzung von Regeln ein Bruchteil dessen gewesen.
Man spart am falschen Ort – und zahlt später ein Vielfaches. Noch gravierender ist der langfristige Effekt. Wenn ein Land beginnt, bei zentralen Themen wie Sicherheit, Jugendschutz und Kontrolle als „nachlässig“ wahrgenommen zu werden, verliert es einen Teil seiner moralischen Autorität. Dann ist die Schweiz nicht mehr das Land, das erklärt, wie man Dinge richtig macht. Sondern eines, das sich rechtfertigen muss.
Und genau das ist der Preis des Wegschauens. Nicht nur in Franken. Sondern in Glaubwürdigkeit.
Regeln, Tickets und das verlorene Vertrauen
Was viele Menschen im Moment empfinden, ist schwer in Zahlen zu fassen. Es ist kein einzelner Ärger. Es ist ein Grundgefühl.
Man lebt in einem Land, in dem Regeln sehr genau gelten – für den Einzelnen. Fünf Minuten zu lang parkiert? Ticket. Ein Formular falsch ausgefüllt? Mahnung. Eine Frist um einen Tag verpasst? Konsequenzen. Der Staat funktioniert. Präzise. Unerbittlich. Zumindest dort, wo es einfach ist.
Und dann gibt es Bereiche, in denen es wirklich zählt. Innere Sicherheit. Jugendschutz. Brandschutz. Verantwortung für öffentliche Räume.
Und genau dort scheint plötzlich vieles unverbindlich zu werden. Zuständigkeiten verschwimmen. Kontrollen bleiben aus. Niemand fühlt sich wirklich verantwortlich.
Dieser Kontrast macht etwas mit den Menschen. Er erzeugt Zynismus. Er nährt das Gefühl, dass Regeln nicht für alle gleich gelten – sondern vor allem für jene, die sich ohnehin daran halten.
Man beginnt sich zu fragen: Warum ist der Staat so effizient beim Sanktionieren von Kleinigkeiten, aber so langsam, wenn es um den Schutz von Leben geht? Und bei den «Grossen»?
Und irgendwann stellt sich eine noch grundlegendere Frage: Warum vertraut eigentlich niemand mehr der Politik?
Vielleicht, weil Verantwortung zu oft delegiert wird.
Vielleicht, weil man lieber verwaltet als gestaltet.
Vielleicht, weil Fehler nicht offen benannt, sondern juristisch abgefedert werden.
Vielleicht auch, weil Nähe zu Macht und Geld zu selten kritisch hinterfragt wird.
Vielleicht weil zwar Verwaltungsräte und Unternehmer für alles haften, Politiker für nichts.
Korruption muss nicht immer in Umschlägen stattfinden. Manchmal reicht Gleichgültigkeit. Manchmal reicht Wegschauen. Manchmal reicht das stille Einverständnis, dass man „es schon irgendwie regeln wird“.
Politiker und Entscheidungsträger sollten sich nicht nur fragen, wie es zu einer solchen Tragödie kommen konnte. Warum seltsame Parteien gewählt werden.
Sie sollten sich fragen, warum das Vertrauen so brüchig geworden ist. Warum Bürger sich abwenden. Warum Resignation lauter wird als Engagement.
Diese Tragödie wird aufgearbeitet werden. Es wird Berichte geben. Untersuchungen. Vielleicht auch Konsequenzen.
Die entscheidende Frage ist nur: Wird man wirklich etwas ändern – oder nur formell reagieren?
Denn eines ist klar. Ein funktionierender Staat misst sich nicht daran, wie konsequent er Parkbussen verteilt. Sondern daran, wie ernst er den Schutz seiner Kinder nimmt.
Und daran, ob er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – bevor etwas passiert.
Aber jetzt schaue ich erstmal ein paar Minuten zum Fenster hinaus.